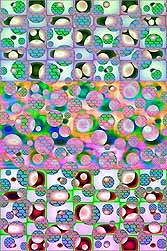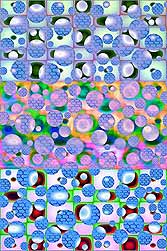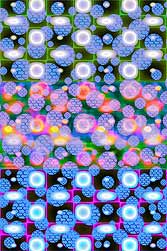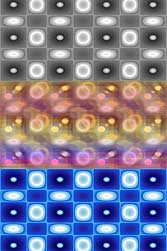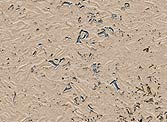| |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Michael Wagner
spectralanalysis 6
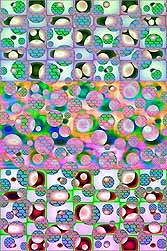
|
|
16. April 2005
"Ästhetik des Erhabenen"
"Le sublime est ... la mode" - das Erhabene ist in Mode.
Mit diesem Wort des französischen Kunsttheoretikers
Jean-Luc Nancy eröffnet Christine Pries ihr Buch über einen
ästhetischen Gegenstand, der nun bald zweitausend Jahre
philosophische und künstlerische Gemüter bewegt. -
(Christine Pries Hrsg.: Das Erhabene. Zwischen
Grenzerfahrung und Größenwahn. Weinheim 1988. S. 1)
- Dabei ist das Erhabene kein Thema, das sich gegenüber
den Versuchen nach eindeutiger Klassifizierung als besonders
gefällig erweist. Es scheint sich der Macht des Begrifflichen
entziehen zu wollen und aus jener Grauzone des Erfahrbaren
zu stammen, wo auch das Paradoxe und Ambivalente sein
Heimrecht hat. Es bezeichnet eine Grenze des Ästhetischen
und macht sich doch ästhetisch fühlbar. Dieses Gefühl erweckt
Lust und durchkreuzt sie doch zugleich, indem es die Ahnung
von etwas Unfaßlichem und Ungeheurem vermittelt. ...
|
| |
 |
|
|
|
spectralanalysis 5
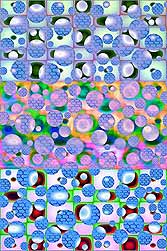
|
|
15. April 2005
"Vom analogen zum digitalen Code"
Auch Peter Weibel spricht nicht von einem Bild,
wenn er die digitale Form der Bilderzeugung
»In der Chronokratie« beschreibt und die
Unterschiede zu den klassischen technischen
Bildmedien Fotografie und Film darlegt. Das
digitale Bild ist für ihn ein kontextkontolliertes
Ereignisfeld aus akustischen, visuellen oder
olfaktorischen Variablen.
Das digitale Signal ist ursprünglich neutral,
erst die technische Schnittstelle,
der technische Kontext, verändert es in ein Bild
oder Tonsignal, in ein spezifisches Ereignis.
Das Bild wird zu einem Ereignisfeld. ...
|
| |
 |
|
|
|
spectralanalysis 4
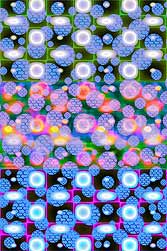
|
|
14. April 2005
"Das digitale Bild"
Wenn man gegenwärtig nicht nur von einer
»virtuellen Kultur«, sondern auch von einer
»Bildschirmkultur« spricht, sollte man eins
dabei nicht vergessen: das Objekt selbst,
den statischen Träger der Bildgeschwindigkeit.
Denn die Konfiguration des Bildschirms und
die Architektonik der Bildschirmwände stellen
eine wirkliche Umwelt dar, in der das Objekt sich
als eine kollektive mentale Form definiert.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die
Wortschöpfung »daO« von Chup Friemert
aufmerksam machen, denn in seinem Essay
»Daoismus« untersucht er ausführlich die
Hardware-Konfiguration des Bildschirms bzw. das,
was an die Stelle der klassischen Bilder tritt: ...
|
| |
 |
|
|
|
spectralanalysis 3

|
|
13. April 2005
"Synthetisches Bild"
»Bis zum Einbruch der Elektronik bezogen sich Bilder auf
»nachprüfbare« Gegenstände. Es existierte also etwas,
das ihnen entsprach. Alles situierte sich in den
etablierten Bezugsrahmen, die es uns erlaubten sie
wiederzuerkennen. Seitdem sie aber von den Kathoden
des Bildschirms aufgezeichnet werden, destabilisieren
sich Gegenstände, Kategorien, Kriterien und Normen.«
(René Berger, Kunst und neue Technologien. In:
Kunstforum Bd. 97, November/Dezember 1988)
Beim numerischen Bild existiert im Unterschied
zu Fotografie und Film keine Analogie zwischen
Repräsentation und repräsentierten Gegenstand,
vielmehr ist es geprägt von einer Inflationierung
der Dimensionen verbunden mit einer Entwertung
der sinnlichen Erkenntnis . ...
|
| |
 |
|
|
|
spectralanalysis 2

|
|
12. April 2005
"Auratisch"
... Den Bereich des Echten und der Aura beschränkt
Walter Benjamin nicht auf historische Artefakte, er
bindet den Begriff der Aura vielmehr an ein bestimmtes
Gewahrsein der Welt: Die Aura "definieren wir als
einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag.
An einem Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug
am Horizont oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten
auf den Ruhenden wirft - das heißt die Aura dieser Berge,
dieses Zweiges atmen."
Benjamin beschreibt hier als auratisch die Erfahrung einer
singulären und subjektiv erlebten Präsenz - ganz ähnlich
wie Capra, Gelpke oder Huxley solches Gewahrsein im
Zusammenhang einer dem Alltagsbewußtsein gegenüber
erweiterten Wahrnehmung beschrieben haben. ...
|
| |
 |
|
|
|
spectralanalysis
series, 1/12
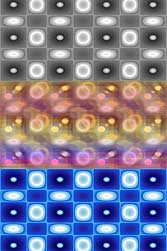
|
|
11. April 2005
"Menschliche Imaginationskapazitäten"
Heute ist unser ganzes Weltbild von Apparaten oder
"technischen Vorrichtungen" wie Vilém Flusser sie nennt,
geprägt und wir nehmen immer ihren Standpunkt ein,
auch dann, wenn wir ein prähistorisches Bild aus Lascaux
oder ein historisches aus Florenz betrachten. Das bedeutet,
dass wir die alten Bilder im Kontext des modernen Weltbildes
empfangen bzw. entschlüsseln und das apparatisch.
Die Flucht aus der Bilderflut zurück zu den alten guten Bildern
sieht Flusser daher verwehrt, so dass nur der Versuch bleibt,
die Flucht nach vorne ins neue Jahrtausend zu »neuen Bildern«
bzw. zu neuen Weisen der Bilderzeugung anzutreten. ...
|
| |
 |
|
|
| |
mountaincross

|
|
9. April 2005
"Mountaineer"

friends from japan
|
| |
 |
|
|
|
transmission

|
|
8. April 2005
"Abstrakte Fotografie"
... Danach soll nun – als zusammenfassende Definition –
Abstrakte Fotografie als Sammelbegriff für eine Kunstform
verstanden werden, in der die gegenständliche fotografische
Abbildung zugunsten fotografischer Strukturbildungsprozesse
in den Hintergrund tritt. Im Vordergrund steht die
Visualisierung einer (abstrakten) Idee, die unter bewusster
Vernachlässigung von Aspekten der Gegenständlichkeit und
Wiedererkennbarkeit fotografisch realisiert wird.
Dabei gelingen Bildaussagen, die mit den Mitteln des
fotografischen Abbildes nicht möglich sind und die über
dessen Wirkung hinausgehen. Das Gebiet schließt sowohl
die Abstraktion (von Wirklichkeit) als auch die Konkretion
(von Möglichkeit) in sich ein. ...
|
| |
 |
|
|
| |
solitaire

|
|
7. April 2005
"Wasserbildner"
Wasser ist die Kohle der Zukunft.
Jules Verne 1874
Das Element wurde 1766 von Henry Cavendish entdeckt.
Es wurde jedoch schon im 16. Jahrhundert von Paracelsus
durch Umsetzung von Eisen mit Schwefelsäure hergestellt.
Der französische Chemiker Antoine Lavoisier stellte 1783
erstmals "künstliches" Wasser aus Wasserstoff und
Sauerstoff her. Außerdem führte er Versuche zur Zerlegung
von Wasser durch. Auf Lavoirsier ist auch die Bezeichnung
des Elements zurückzuführen. Er bezeichnete den Wasserstoff
als " hydrogène (aus dem Griechischen "Wasserbildner").
1932 entdeckte H.C. Urey, F.G. Brickwedde und G.M. Murohy
das Isotop Deuterium und zwei Jahre später beschrieben
M.L.E. Oliphant, P. Harteck und E. Rutherford
erstmals das Isotop Tritium. ...
|
| |
 |
|
|
|
trace elements
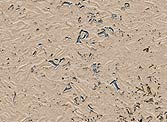
|
|
6. April 2005
"Newton, Mystik und Magie"
Was hat unsere alltägliche Welt mit derjenigen
der Quanten zu tun? Entstand unsere Welt
in einem ungehörten Knall, oder entsteht sie
ständig im menschlichen Bewusstsein -
oder beides zugleich? Ist unser Wille die kultivierte,
bereits im Mikrokosmos angelegte
"individuelle" Möglichkeit im evolutionären Spiel
von Zufall und Notwendigkeit. ...
|
|
 |
|